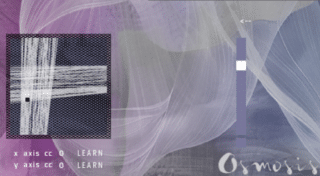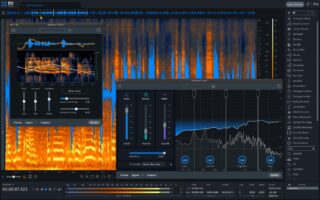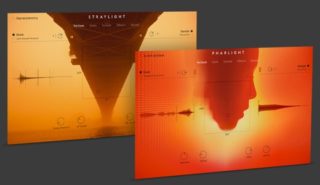Die Marke Native Instruments
Diese Firma ist einzigartig. An allen möglichen Konkurrenten vorbei hat sie sich seit ihrer Gründung 1996 von einem Team aus sechs Freunden zu 400 Leuten hochgearbeitet und dabei ihr Profil nicht verloren – das Profil einer Schmiede interessanter und stimmiger Werkzeuge für Musiker, von dem frei programmierbaren Instrumentenbautool Reaktor über die Hammond-Emulation B4 bis zum abgefahrenen Software-Synthesizer Absynth.

Nicht jedes dieser Werkzeuge ist für jeden Anwender geschaffen, doch das Niveau all dieser Produkte ist hoch, und zwar vom Code bis zur Dokumentation. Kaum ein Musiker heute, der mit dem Computer arbeitet und nicht das eine oder andere Instrumente von Native Instruments auf seiner Festplatte hat.
Insights: Die Native Instruments Story zum Jubiläum
Welche Ideen ursprünglich stecken hinter Native Instruments, was davon ist seit 1996 übrig geblieben, was macht die Menschen, die hier arbeiten, und den „Spirit”, der hier herrscht, aus? Das hat Maximilian Schönherr zum 10-jährigen Jubiläum 2016 versucht zu ergründen:
Es war ein kühler Sommermorgen, als ich in Kreuzberg ankam. Wenn man die Schlesische Straße entlang läuft, übersieht man Native Instruments leicht, denn das Schild ist klein und unscheinbar. Man muss sich in den zweiten Hinterhof vortasten, wo ein Native Instruments Schild an der Tür hängt, was auch nicht gerade protzt. Erst im dritten Stock dann Gewissheit: die Rezeption und Leuchtflächen mit nach hinten in die Wand eingelassenen Dias der wichtigsten Produkte.
Die junge Frau, die sich gerade in der Küche gleich am Eingang zwei Wurstbrote schmiert, fragt mich, wen sie für mich rufen soll, und wenige Minuten später steht ein aufgeräumter Tobias Thon vor mir. Tobias Thon vertritt seit einigen Jahren die Firma nach außen, und er kennt den ganzen Laden innen vielleicht besser als die meisten, die hier arbeiten. Zudem – und das ist für einen PR-Mann nicht unbedingt typisch – kennt er die Produkte ziemlich gut.
Wie alle PR-Leute muss er den Spagat machen zwischen Locken und Verbergen. Zum Beispiel darf ich nichts über den neuen Software-Synthesizer sagen, der Klänge liefern soll, die irgendwo zwischen Virus und Nord Lead liegen. „Wozu eigentlich noch ein Software-Synthesizer, wo es doch schon so viele gibt?”, frage ich später den Gründer von Native Instrument, Stephan Schmitt, einen ruhigen, leise sprechenden Mann Ende 40.
„Klar, der Markt ist mit Software-Synthesizern ziemlich besetzt”, antwortet er. „Wir haben aber lange Zeit keine neuen Synthesizer mehr auf den Markt gebracht und halten es für spannend, hier ein Statement zu geben, indem wir ein prägendes Instrument in die Welt setzen.” Wenn Stephan Schmitt das sagt, kann man sich darauf verlassen, dass das Instrument zumindest für Aufsehen sorgen wird. Native Instruments kleckert hier nicht, sondern klotzt.
Das sieht man schon an den Leuten, die ins Beta-Testing mit einbezogen werden, etwa der bestbezahlte Komponist für Filmmusik aller Zeiten, Hans Zimmer.
Erste Versuche mit DDR-Mischpulten
Stephan Schmitt plagte in den frühen 90er Jahren der Gedanke, dass er mit seinem Yamaha DX7/II-Synthesizer, einem Instrument, das er von Grund auf kannte und mit dem er in kleinem Kreis solo oder zusammen mit einem Gitarristen auftrat, an die Grenzen stieß.
„Eine Firma wie Yamaha macht nichts mehr, um diese Grenzen zu erweitern. All das, was man in so ein Instrument investiert hat, um es kennen und beherrschen zu lernen, wird nicht gewürdigt. Man kann es quasi wegwerfen, weil der neue Yamaha-Synthesizer wieder ganz anders funktioniert. Ich hatte die Schnauze voll von dieser Industrie, von den großen Instrumenten, die von den Japanern angeboten werden.

Das in Software zu machen, war zunächst unmöglich, weil die Hardware, dieser Spezialchip, der in so einem DX7 drinsteckt, extrem leistungsfähig ist. Anfang der 90er-Jahre aber, mit der Ankündigung des ersten Pentium-Prozessors, sah ich die große Chance, mein eigenes Instrumentensystem auf einem normalen PC zu entwickeln.”
Wie viele Gründerväter der Softwarebranche ging auch Stephan Schmitt nicht den normalen Weg eines akademischen Abschlusses und der braven Anstellung in einem großen Konzern wie Siemens. Kurz nach der Wende riss ihn ein verlockendes Angebot aus seinem Studium der Elektrotechnik in Braunschweig und zog ihn nach Ostberlin.
Da war eine Firma als Tochter eines westdeutschen Unternehmens gegründet worden, mit der Idee, die Spitzenkräfte der DDR-Rundfunktechnik – sie waren für alle Mischpulte und Studioeinrichtungen der DDR zuständig gewesen – mit West-Technik neue Mischpulte entwickeln zu lassen. Zunächst evaluierte Stephan Schmitt das Projekt und wurde später sein Entwicklungsleiter.
Ein gut bezahlter Job? „Für meine Verhältnisse war das sehr gut bezahlt: ein typisches Ingenieursgehalt um die 5000 Mark.” „Verdienst du heute mehr?” „Ja!” [lacht] „Aber dir gehört nicht der blaue Porsche Cayenne Turbo, der da unten im Hof parkt?” „Nein, mir gehört das Fahrrad, was da unten steht. Ansonsten fahre ich einen Mitsubishi Colt.”
Die Mischpultfirma ging pleite, als die Fördermittel zu Ende gingen und sie noch immer kein marktreifes Produkt vorweisen konnte. Jetzt stand Stephan Schmitt arbeitslos und ohne Studienabschluss da und sah sich dem Druck ausgeliefert, als Selbständiger erfolgreich zu werden.
In der Firma hatte er einen Werkstudenten, der ein wenig programmieren konnte, kennengelernt, Volker Hinz. Die beiden taten sich 1993 zusammen und versuchten, 386er- und 486er-PCs Töne zu entlocken.
„Ich musste selbst lernen, wie man Software schreibt, und hatte auch Lust darauf, weil ich gemerkt hatte, dass man mit Software sehr viel Gestaltungsfreiheit hat. Es war damals klar, dass Audio in Zukunft komplett digital sein würde.”
Generator und die Idee softwarebasierter Instrumente
Die Grundidee von Generator, wie die „Zukunft” heißen sollte, war ein rein softwarebasiertes Instrument, „ … das dem Programmierer viele Möglichkeiten lässt und auch dem User später noch viele Möglichkeiten bietet. Volker und ich wollten einen Synthesizer für einige hundert Mark anbieten. Das war ein Zehntel des gängigen Preises für einen Hardware-Synthesizer.”
Während Generator wuchs und Windows-Rechner mit dem leistungsfähigeren Pentium-Prozessor ausgestattet waren und immer weniger Interrupt-Probleme aufwiesen, hielt sich Stephan Schmitt mit Jobs in der Studioindustrie über Wasser. Im Frühjahr 1996 begleitete er seinen Arbeitgeber zur Musikmesse/ProLight&Sound, und während dieser Mischpulte ausstellte, baute Stephan Schmitt seinen PC auf und zeigte dem ahnungslosen Laufpublikum den ersten Generator-Prototypen.
„Mein Chef hat mir dann einen Tritt in den Hintern gegeben und – ich rechne ihm das heute hoch an – gesagt: Jetzt gehn’se ma hin zu der Presse!”
Scheu gab Stephan Schmitt zwei „Pamphlete” bei den Ständen der einschlägigen Musikzeitschriften ab und bekam wenig später tatsächlich Besuch von zwei Herren, die die Bedeutung von Generator offenbar begriffen und euphorisch in ihren Zeitschriften darüber berichteten. „Mein Chef sagte anschließend: ‚Herr Schmitt, Sie pinkeln jetzt mit den Großen!’” Das Medieninteresse war der Auslöser, eine Zwei-Mann-Firma zu gründen, die Native Instruments GbR.

Damit Generator zum fertigen Produkt wurde, brauchten die beiden Techniker Hilfe. 1997 stießen vier von der Idee begeisterte Leute dazu, darunter auch ein Lockenkopf, der gerade mit dem Studium fertig war (mit einem Diplom über Echtzeitklangerzeugung mit Physical Modeling), Michael Kurz: „Ich hatte durch Unikontakte erfahren, dass es einen verrückten Erfinder namens Stephan Schmitt gibt, der einen Software-Synthesizer entwickelt, hab Kontakt aufgenommen, war beeindruckt von seinem Projekt und seiner Vision, auch was den Markt betrifft, und hab gesagt, da würde ich gern mitmachen.”
„Gab’s nach dem ersten Monat Gehalt?” „Nein, wir waren sechs Gesellschafter und haben das erste Jahr mehr oder weniger ohne Gehalt gearbeitet, unsere eigene Arbeitskraft investiert und damit die Firma aufgebaut, als Unternehmer. Erst später haben wir Angestellte gehabt. Mit Risikokapitalgebern konnten wir dann Räume in Berlin Mitte anmieten. Jetzt, seit Native Instruments eine GmbH ist, sind wir alle angestellt.”
Michael Kurz verdanken wir die virtuelle Hammond B4, die Emulation des Yamaha DX7 als FM7 und die Simulation von Lautsprecherkabinetten bei Guitar Rig. Er arbeitete zur Zeit des Interviews mehr zu Hause als in der Firma und brachte für das Treffen eigens eines seiner Lieblingshardwareobjekte mit: eine Elektronenröhre aus einem Gitarrenverstärker.
Wie Native Instruments seine Spitzenposition seit Jahren hält
Wie Stephan Schmitt ist Michael Kurz eine eher zurückhaltende Person, ein typischer Tüftler eben. Wie ist es möglich, ein sensibles Ding wie den Spirit in einer Firma zu erhalten, die in 10 Jahren von sechs auf 130 Mitarbeiter anwächst?
„Wir suchen sehr lang nach Leuten, die wir einstellen”, erklärt Stephan Schmitt und runzelt die Stirn. „Vor allem im Sales Bereich ist es sehr schwer, jemanden zu finden, der auch zu uns passt. Bei den Programmierern ist es leichter.
Da haben wir immer wieder hoch begabte Leute gefunden, die hoch motiviert sind, an einer doch etwas ungewöhnlichen Software mitzuarbeiten, die sich erheblich unterscheidet von Datenbanken und SAP-Anwendungen, womit 90% der Informatiker zu tun haben. Dass man das, was man programmiert hat, hören kann und dass es in der Musik Einsatz findet, fasziniert viele.”
Michael Kurz hat gerade einen seiner Verantwortungsbereiche an einen solchen neuen Programmierer abgegeben: „Dennis Noppeney kam vor einem Jahr mit einem exzellenten Diplom in Elektrotechnik zu uns. Ich habe jetzt die Röhrenverstärkerforschung, die ich in den letzten Jahren betrieben habe, komplett an ihn übergeben.”

„Tat die Übergabe weh?” Pause – und dann: „Ja, man muss jemanden finden, dem man vertraut und der mit vollem Herzen dabei ist, der handwerklich gut damit umgeht und das aus Berufung tut. Ich musste die Röhren abgeben, weil ich mich jetzt um ältere Projekte wie den FM7 kümmern muss. Die Lautsprechersimulation wird übrigens in die B4 einfließen.”
Nur ein harter Kern der Firma forscht an neuen Klangerzeugungsmöglichkeiten. Eine große Abteilung von Programmieren beschäftigt sich nur mit der Wiederverwertbarkeit von Code, damit etwa der Browser von Kore mit seiner Klangtypisierung („warmer Bass” etc.) in den neuen FM7 einfließen kann und die Hammond endlich vernünftige Boxen und Effekte bekommt, wie man sie von Guitar Rig kennt.
„Viele Entwickler bei uns kümmern sich ausschließlich darum, dass eine Software in jedem Rechner funktioniert”, sagt Michael Kurz. „Als ich vor sechs Jahren meine Hammond B4 entwickelt habe, musste ich noch nicht so viele Schnittstellen bedienen und Betriebssysteme unterstützen wie heute. Die B4 war einfach ein Standalone-Programm und ein VST-Plug-in.”
Im Jahr 2000 war Native Instruments noch eine kleine Firma, nur ein Sechstel so groß wie zum Zeitpunkt des Interviews, und es klingt fast romantisch, wie direkt Michael Kurz damals seine Hammond-Idee einbringen konnte. Er weiß es noch ganz genau:
„Ich hab gesagt, wir sollten mal eine Hammond-Orgel machen. Ich glaube, ich weiß, wie das geht, also fang ich jetzt mal damit an. Da haben die Kollegen gesagt: ‚Na gut, klingt vernünftig, also machen wir das.’ Heute liefe das anders, denn wir haben Management-Strukturen, und alles ist bürokratischer als damals.”
Zum Beispiel gibt es seit vier Jahren den „CTO”, den Chief Technology Officer, der ein Produkt von der ersten Idee bis zur Auslieferung technisch begleitet. CTO bei Native Instruments ist Michael Hirsch, der meine Frage, ob er Programmcode lesen kann, fast als Beleidigung auffasst:
„Selbstverständlich! In unserer Branche muss alles erstens auf allen Plattformen mit allen möglichen Schnittstellen und zweitens in Echtzeit laufen. Deshalb unterscheidet sich die Arbeitsweise nicht signifikant von 1992. Wir müssen sehr nah am Rechner arbeiten. C++ ist die Sprache, die wir sprechen. Unsere Entwickler müssen Hardcore-Programmierer sein, die C++ aus dem Effeff können und Meister ihres Fachs sind.”
Die Entwicklung von Kore und Reaktor
Michael Kurz hat seine Hammond-Simulation innerhalb eines halben Jahres auf die Beine gestellt – eine Bilderbuchgeschichte. Gab es denn auch Projekte, die mittendrin stecken blieben?
„So was gab’s oft”, räumt CTO Michael Hirsch ein. „Da möchte man die Projektnamen gern vergessen. Für Kore gab es mehrere Anläufe, aber die Technik und der Markt waren noch nicht reif. Reaktor war schon immer ein schwer beherrschbares Biest und treibt mich wegen der Komplexität manchmal in den schieren Wahnsinn.

entwickelte Hardware-
Controller mit hochauflösenden,
berührungsempfindlichen Encodern
und Audio-Interface (Bild: Archiv)
Manchmal haben wir einen Algorithmus, der toll klingt, eine Syntheseform, die sehr viel verspricht, dann aber nicht zu beherrschen ist. Wir versuchen heute, solche Ideen frühzeitig zu prüfen. Oft muss man aber auch eine Weile forschen, bis man das entscheiden kann.”
Trotz einer härteren Evaluierung im Vorfeld sind Projekte, die auszuufern drohen, ein Dauerthema bei Native Instruments. „Wir mussten in den letzten Jahren hart lernen, dass in einer professionellen Firma Produkte nicht nur in-Quality, sondern in-Time auf den Markt kommen müssen. Oft fliegen wegen des Zeitdrucks fest eingeplante Features raus, tauchen aber in späteren Versionen auf. Wir machen heute nur noch wenig doppelt.”
Ein Thema, an dem der Technikchef seit Jahren knabbert, ist die Additive Synthese, also Software, mit der praktisch beliebige Klänge aus einer Reihe von Grundschwingungen aufgebaut werden können. „Wir haben es bisher nicht hingekriegt, die Additive Synthese sinnvoll beherrschbar zu machen”, sagt Michael Hirsch. „Wir haben es mit Hunderttausenden von Parametern zu tun. Das geht bis zum Zeichnen der Wellenform.
Die Komplexität macht den Reiz aus, aber dummerweise fehlt es an Konzepten, die diese Flut an Parametern durch eine Eingabe oder das Drehen von Reglern zu einem einigermaßen vorhersehbaren Sound leitet. Es gab schon Ideen, einen dreidimensionalen Körper durch einen wolkigen Raum entlang komischer Achsen zu schieben (grinst).
Wir haben sogar einige Diplomarbeiten auf diesem Gebiet angeregt; die teilweise zu sehr ulkigen, aber für uns nicht überzeugenden Ergebnissen kamen.”
Einen Tag früher als erwartet kommt braungebrannt Daniel Haver aus dem Urlaub zurück. Es gab nicht mehr genug Wind zum Kite-Surfen. Er ist ein Naturtalent, sich spontan auf jedermann einzustellen und steht mir trotz Jetlag sofort und unkompliziert Rede und Antwort.
Wie schon zuvor der CTO reicht auch er mir seine Visitenkarte: „CEO Daniel Haver” – Chief Executive Officer.
Seit wann und warum nennt er sich CEO? „Ich habe meine Titel immer so ausgewählt, dass sie mit der Größe des Unternehmens kompatibel waren”, erklärt Daniel Haver. „Das heißt, ich habe angefangen als General Manager, habe mich dann umbenannt in Managing Director und nach vier Jahren dann CEO getauft. Wenn man im deutschen GmbH-Recht denkt, gibt es zwei Geschäftsführer, Stephan Schmitt und mich, die landläufig dasselbe tun.
Aber wir sind ein international agierendes Unternehmen und eher angelsächsisch strukturiert, wo der CEO der Mann ist, der den Takt in allen Dingen angibt, und dieser CEO bin ich.”
Auch Daniel Haver gehört zu den frühen sechs Mitgliedern von Native Instruments, mit denen er seine musikalische Passion teilte, von denen er sich aber deutlich unterschied, weil er nicht lötete, nicht programmierte, sondern sich für den Markt interessierte.
Ohne ihn wäre die Firma vielleicht heute noch ein kleiner Laden von Tüftlern, die vor genialen Ideen platzen, aber nichts so richtig verkaufen können.
Zu Daniel Havers der angelsächsischen Geschäftswelt entlehnten Ideen gehört die Einführung von PEC-Sitzungen, wo jeder Mitarbeiter seine Vorschläge für neue Produkte unterbreiten kann. „Wenn jemand eine solche Idee an mich heranträgt und sie mir viel versprechend vorkommt, berufe ich genau diese berühmten ‚Product Evaluation Committees’ ein und stelle dann Kompetenzteams zusammen.
Für ein Gitarren- oder DJ-Thema wird das natürlich ein ganz anderes Team als für Kore sein. Stephan Schmitt ist in jedem Fall mit drin, außerdem Mate Galic, der neben Stephan einer unserer Top-Visionäre ist.”
Native Instruments und Ableton
Einer der ersten sechs Gesellschafter verließ 1999 die Firma, um mit einem eigenständigen Produkt Ableton zu gründen: Bernd Roggendorf. War das ein Trauma für Native Instruments? „Das Trauma war weniger, dass Bernd gegangen ist, sondern bestand darin, dass so eine Krise überhaupt aufkommen konnte”, entgegnet Daniel Haver.
„Wir mussten uns alle zusammenraufen und auf einen Kurs verständigen, den Bernd nicht mitgehen konnte. Er hat dann die Firma zusammen mit Gerhard Behles, einem freien Mitarbeiter, verlassen. Wir waren damals – und sind es im Grunde heute noch – ein Hersteller von Software-Instrumenten.
Das war das Geschäft, mit dem wir angefangen hatten, in dem wir gut waren und wo wir gerade anfingen, erfolgreich zu werden. Ich und die anderen haben daran geglaubt, dass das eine große Zukunft hat, während Bernd einen Sequenzer machen wollte.
Wir hätten damals vom Fokus und von den Ressourcen her nie Ableton Live machen können.” Stephan Schmitt sieht das emotionaler: „Das war sehr schade, auf diese sehr begabten Leute verzichten zu müssen.” „Die liefen aber nicht mit Wissenskapital aus der Firma davon?”
„Das nicht. Aber die haben natürlich bei uns gelernt, eine Menge Fehler, die wir in unserer Anfangsphase gemacht haben, zu vermeiden. Abgesehen davon hatten sie eigene Ideen, und ich respektiere sehr, was sie geschaffen und wie konsequent sie es umgesetzt haben.”
Wie arbeitet man bei Native Instruments?
Tobias Thon, der Pressemann, der mich den ganzen Tag von Raum zu Raum, von Gebäudeeinheit zu Gebäudeeinheit, von Person zu Person führt, ist stolz auf den Ablauf der Produktentwicklung bei Native Instruments und malt mir die nächsten Schritte auf, nachdem eine Idee die PEC-Sitzung erfolgreich durchlaufen hat.
Als Nächstes wird geklärt, ob die Idee überhaupt in die Strategie des Unternehmens passt und sich rechnen würde. Danach startet das Produktdesign, wo festgelegt wird, was das Programm wie tun soll. Erst in der folgenden Phase, der Implementation, beginnen Software-Ingenieure mit dem Schreiben von Code, der Engine, dem Interface.

Wenn dann auch die Schnittstellen (MIDI,VST etc.) eingebaut wurden, gelangt das Produkt in den ersten Praxistest: Bei sogenannten Listening-Sessions dürfen ausgewählte Musiker ihre Finger in die offenen Wunden legen. Für den Feinschliff an Guitar Rig etwa bat man die Gitarrenband Guns And Roses zu Listening-Sessions ins Studio in Los Angeles.
Native Instruments unterhält seit Jahren ein kleines Büro in der kalifornischen Metropole. Eine ganze Abteilung beschäftigt sich parallel damit, für das neue Produkt „Content” bereitzustellen. Damit sind beeindruckende, das Instrument in seinen Stärken abbildende Klangbibliotheken gemeint.
„Ohne Content kann man heute nichts mehr verkaufen”, sagt Stephan Schmitt. „In Synthesizern früher hießen sie Werksounds. Die Sounddesign-Abteilung ist bei uns extrem wichtig.”
Währenddessen beschäftigen sich Grafiker mit dem endgültigen Interface-Design und der Gestaltung der Verpackung, Marketing und Presseabteilung legen den Erscheinungstag fest.
Die Q&A-Gruppe (Question & Answer) versucht, mit Härtetests Schwächen der inzwischen fast fertigen Version auszuloten, etwa indem sie sie gezielt an die Grenzen und damit eventuell zum Absturz bringt; wenn das gelingt, müssen die Programmierer dann entsprechend nacharbeiten. Schließlich werden die CDs gepresst, und die Auslieferung beginnt.
Wie alle Softwareunternehmen könnte Native Instruments ein Vielfaches an Umsatz machen und noch viel mehr Leute einstellen, wenn es mehr zahlende Kunden gäbe. Die weitaus meisten Anwender der Programme aber besitzen illegale Kopien, die mit Cracks (Key Generators) freigeschaltet werden.
Für Native Instruments sind sie User zweiter Klasse, ohne Support, ohne die Privilegien von Web-Updates. Die Frage, wie ein modernes Unternehmen der Musiksoftwarebranche, welches um die leeren Geldbeutel von Musikern weiß, mit sogenannten Raubkopierern umgeht, wird ein Geschäftsmann wie der CEO anders – diplomatischer – beantworten als der Elektroingenieur, der den Laden gegründet hat, Stephan Schmitt:
„Wir haben sehr harte Zeiten durchgemacht und sind keine Firma, die völlig abgesichert in Geld schwimmt und der Raubkopien nicht weh tun. Bei uns ist noch keiner reich geworden. Ohne die zahlenden Kunden wäre keine Neuentwicklung möglich.
Für eine junge Firma ist es so, dass allein durch die Verbreitung ihrer Software ein Marketingeffekt erzielt wird, ganz gleich, wie diese Verbreitung geschieht, auf legalem oder illegalem Weg.
Man wird bekannt, ist auf vielen Rechnern drauf, wird vielleicht zum Standardwerkzeug. Bei Generator hat es uns vielleicht eine Zeitlang geholfen, dass Cracks im Umlauf waren. Wir hatten schon immer einen Kopierschutz eingebaut, wobei der nie so hart wie z. B. bei Steinberg war.”
Nur in einem Fall ist die Firma bisher gegen einen Raubkopierer vorgegangen, weil dieser gecrackte Software über Kleinanzeigen weiterverkauft hatte.

„Wenn einer Geld mit unseren Produkten verdient, hört für mich der Spaß auf. Da ist die kriminelle Energie so hoch, dass man die Staatsanwaltschaft damit beschäftigen sollte. Ich bin inzwischen überhaupt dafür, dass Polizei und Staatsanwaltschaft härter vorgehen, um dieses Gefühl zu stören, dass jedermann eine Schwarzkopie benutzen kann, ohne je erwischt zu werden.”
Bei meinem ganztägigen Rundgang fällt mir auf, dass die meisten Mitarbeiter relativ jung sind; viele kommen aus der DJ-Szene. Die Chefs sind hier, wie es sich gehört, die Ältesten. Wie geht Stephan Schmitt mit dem Problem des Generationswechsels um und damit, dass mancher junge Kollege heute vielleicht schneller und frischer denkt als er?
Nach kurzem Nachdenken meint der Native Instruments Gründer: „Kann gut sein, dass hier einige sind, die erheblich innovativer sind als ich. Es ist eine Aufgabe einer Firma wie unserer, solche Leute heranzuziehen und sich dadurch von innen heraus zu erneuern.
Ich bin bald 50, und klar, es gibt Ermüdungserscheinungen. Wenn man 10 Jahre so durchgeklotzt hat, denkt man: Früher war ich in manchen Dingen schneller, vielleicht auch begeisterter.”
„Klingt so, als würdest du am liebsten eine Weile aussteigen und etwas ganz anderes tun. Wie wär’s mit einem Sabbatical-Jahr?” „Ich versuche im Moment, meine eigene Musikaktivität wieder aufzubauen, die völlig unter die Räder gekommen ist. Meine ursprüngliche Motivation war ja, mir ein besseres Instrument zu schaffen.”
Und das hat er ganz offensichtlich geschafft.
Was stellt Native Instruments her?
Die Tüftler von NI sind maßgeblich für drei Produkte bekannt: Die monströse Sound-Library Komplete, der DJ-Controller Traktor und das Production- und Performance-Tool Maschine.
Komplete
Die schier wahnsinnige Soundsammlung der Native Instruments Komplete Audio Pakete zu beschreiben scheint eine ebenso wahnsinnig wie nie endende Aufgabe. Wir haben dagegen den Komplete Kontrol S MIDI-Controller getestet, um ein paar technische Einblicke in die Komplete-Bedienung zu liefern.
Wie die Arbeit mit Komplete aussehen kann, zeigt diese niederschwellige Einführung in Komplete 11:
Zum ausführlichen Test des Komplete Kontrol S MIDI-Controller geht’s hier!
Traktor
Das beliebte DJ-Tool Traktor und die Traktor Kontrol MIDI-Controller sind aus Clubs und Studios nicht mehr wegzudenken.
Was du mit Traktor und dazugehörigem Kontrol anfangen kannst, zeigt dieses Video:
Wir haben den Traktor S5 ausführlich für euch getestet – hier geht’s zum ausführlichen Artikel über das Mixingwunder!
Maschine
Maschine hat mittlerweile einen festen Platz in vielen Producer-Haushalten. Spülen kann sie noch nicht, aber ansonsten wächst sich das hybride Software/Hardware-Gespann mittlerweile zu einem Über-Groove-Tool mit DAW-Ambitionen aus.
Für den gleichen Preis wie beim Vorgänger MK2 kann man seit Oktober 2017 das Maschine-MK3-Paket erstehen, welches aus der der Software Maschine 2, dem MK3-Controller mitsamt Netzteil und USB-Kabel sowie einem Sound-Starter-Kit in Form der Maschine-2-Library und NI Komplete 11 Select (18 GB Sounds bei kompletter Installation) besteht.
Die Software ist im Grunde eine recht komplexe DAW, welche allerdings vordergründig nach reiner Produktions- und Performance-Umgebung aussieht, sich aber wegen ihrer Funktionen bzgl. MIDI-Sequenzing oder Routing auch als Studiozentrale eignet.
Maschine kann man standalone oder als AU/VST-Plug-in innerhalb einer DAW einsetzen. Das Herzstück ist der Pattern-Sequenzer, in welchem die einzelnen Sounds eingespielt, aufgenommen und angeordnet werden. 16 Pads sind jeweils eine Bank, Bänke gibt es acht. Jedes Pad kann ein Sample oder ein VST-Instrument beherbergen. Theoretisch ist es sogar möglich, sich 128 Softsynths vorzulegen, welche dann mit einem Tastendruck spielbereit sind.
Der Controller ist im Gegensatz zu den anderen Maschine-Geschwistern aus matt-schwarzem Aluminium und bringt ganze 2,2 kg auf die Waage. Im Zusammenspiel mit den anderen verbauten Materialien, den Glasdisplays und dem Eigengewicht wirkt Maschine MK3 insgesamt viel hochwertiger als die Plastikbehausungen der Vorgänger.

Mit Maschine MK3 ist Native Instruments ein großer Wurf gelungen: Mit dem neuen Audio-Interface spart man sich zusätzliches Equipment, das mitgelieferte Sound-Paket mit seinen tausenden Sounds und Samples liefert für Neueinsteiger eine stabile Basis, und auch für Maschine-Profis ist die Neuauflage einen Blick wert.
Ein wenig schade ist es, dass NI dem Interface nicht noch zusätzlich einige CV-Outs mit auf den Weg gegeben hat, denn die Zeichen der Zeit sind nun mal modular und es gibt dank des Modular-Hypes zurzeit einige Synthesizer, die man gerne in das Maschine-System einbauen möchte − AKAI z. B. hat dies erkannt, weshalb die aktuelle MPC X CV-Outs mitbringt.
Trotzdem ist Maschine MK3 mit dem hochwertigen Controller, dem Audio-Interface und der Sound-Library ein fast unschlagbares Paket, was das Preis/Leistungs-Verhältnis angeht.
Was man mit einer Maschine anstellen kann, stellt Jeremy Ellis in diesem Video eindrucksvoll unter Beweis:
Texte von Maximilian Schönherr & Martin Mercer
Noch mehr Informationen zu allen Produkten der Berliner Kulthersteller findest du auf der offiziellen Homepage von Native Instruments!